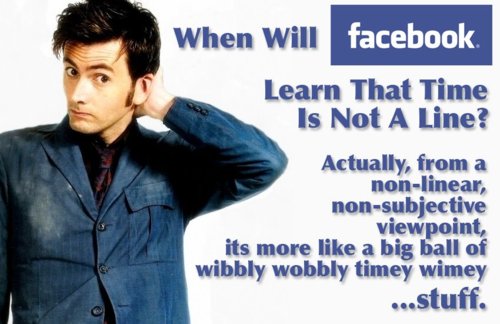Gelegentlich kocht in der Presse das Thema hoch, die Piraten seien von Nazis und/oder Spinnern durchsetzt, wichtige Piraten nähmen es mit der teils braunen, teils fundamentalistischen Vergangenheit nicht so genau oder würden noch immer wunderliche Auffassungen vertreten.
Es ist sicher falsch, die Presse nun einer Kampagne gegen die Piratenpartei zu verdächtigen. Tatsächlich ist es die Aufgabe der Presse, den teils tatsächlich verbesserungswürdigen (weil zu bayrischen) Umgang mit rechten Spinnern zu skandalisieren und auf diese Weise Druck auf Parteien auszuüben. Tatsächlich wäre es wünschenswert, wenn die Presse auch den anderen Parteien gegenüber gründlicher wäre: Schließlich ist Sarrazin noch immer in der SPD, Steinbach noch in der CDU und Geis in der CSU – drei Politiker, die für absolut schwachsinnige Aussagen bekannt sind.
Was unterscheidet aber die Piratenpartei von den anderen Parteien, wenn doch in allen Parteien Spinner unterwegs sind und sich etwa in der hessischen CDU durchaus deutschnationale Kräfte tummeln, die die CDU konsequent ignoriert, duldet und manchmal sogar hofiert? Es gibt tatsächlich einige Unterschiede:
1. Unterschied: Attraktivität
Die für die Piraten sicher ungünstigte Diagnose ist, dass die Partei derzeit für allerhand Spinner attraktiv ist. Es ist leicht, sich zu beteiligen. Es ist ziemlich leicht, ein Parteiamt zu bekommen und vergleichsweise leicht, sich um ein Mandat zu bewerben. Wer, wie ich, einige Jahre in der SPD war, wird das piratische Parteitagschaos der SPD-Mode, über vom Vorstand ausgeteilte Beschlussvorlagen abzustimmen, sicher vorziehen.
Die Piraten machen es also Spinnern leicht, auf die eine oder andere Weise in der Partei mitzuarbeiten. Aber zur Attraktivität gehört nicht nur die Offenheit der Piraten, die sie nicht um alles in der Welt aufgeben dürfen, egal wie viele Spinner angelockt werden. Zur Attraktivität gehört auch, dass das demokratische System in Deutschland de facto unter einer erschreckenden Legitimations- und Identitätskrise leidet. Während sich die meisten Menschen (und praktisch alle Piraten) de jure mit einem demokratischen, föderalen und sozialen Rechtsstaat identifizieren können, hat die politische Kaste ein im Nebel von Worthülsen, Hinterzimmern und Beziehungen verborgenes System geschaffen, das die Mehrheit der Bevölkerung zu bloßen Zuschauern der Demokratie reduziert. In der vollkommenen Sozialdemokratie stimmen wir alle vier Jahre für den großen Vorsitzenden.
Die Piratenpartei verspricht ein Mittel gegen den Nebel zu sein. Daher ist sie, egal wie viele Spinner sich dort tummeln mögen, zunächst einmal ein Kandidat für eine Erneuerung der Demokratie. Ob sie es auch de facto sein wird, wird sich zeigen und auch die klügsten Kommentatoren wissen es einfach noch nicht. Die Offenheit zieht aber nicht nur „Politiker aus Notwehr“ an, die eine Notwendigkeit, eine Pflicht empfinden, sich um öffentliche Angelegenheiten zu kümmern, sondern auch auch alle anderen, die das Bedürfnis nach Veränderung haben – egal ob dieses menschlich, idiotisch oder gar faschistisch ist. Das bedeutet nun aber keineswegs, dass die, die sich als rechte Spinner bei den Piraten erweisen, nun auch wirklich harte Faschisten sind: Auch in politischen Parteien gibt es ein Stockholm-Syndrom, wie ich als ehemaliger SPD-Genosse am eigenen Leib erfahren habe. Wer die Existenz dieses Phänomens bestreitet, sollte sich testweise mit jüngeren FDP-Mitgliedern unterhalten, die unterdessen einen tragikomischen Aufwand treiben, um die eigene Katastrophe mittels kognitiver Dissonanz zu vernebeln. Nicht weniger gibt es auch Menschen, die in einem Veränderungsdruck gefangen auf die dumpfen Versprechen von Rechts reingefallen sind und durch die plumpe Adaption der rechten Ideologie mangels glaubwürdiger parteipolitischer Alternative eben dieser Ideologie entgegen gearbeitet haben. Diese Menschen, so bescheuert ihre vergangenen Aussagen auch gewesen sein mögen, mit harten, d.h. ideologisch gefestigten Rechtsradikalen in einen Topf zu werfen, ist eine dumme Polemik, die sich jeder halbwegs vernunftbegabte Mensch besser sparen sollte.
Auch für die rechten und fundamentalistischen Spinner bei den Piraten gilt also die Lernfähigkeitsvermutung. So wie sich ein RAF-Anwalt zum law-and-order-Innenpolitiker wandeln kann, kann auch eine junge Frau, die sich in einem komplexen und vielleicht ideologisch nicht einwandfreien Umfeld zu dummen Bemerkungen hat hinreißen lassen, zu einer aufrechten Demokratin entwickeln, sobald sie eine demokratische, menschliche und offene Alternative zu den rechten Ideologien hat, um ihren völlig berechtigten Politikfrust zu artikulieren. Die entscheidende Frage darf also nie sein, was jemand früher einmal gesagt hat, solange heute offen und selbstkritisch damit umgegangen wird. Der Versuch, dies einfach unter den Teppich zu kehren, kann dramatisch schief gehen. Es gilt: »Sei transparent! Steh zu Deinen Fehlern! Sei selbstkritisch!« – Und wenn sich kein Lerneffekt einstellt, ja, dann sollte die Piratenpartei solche Leute nicht mit Hausmeisterposten versorgen, sondern schlichtweg rausschmeißen.
2. Unterschied: Sichtbarkeit
Erinnert sich jemand an Martin Hohmann? Ein CDU-Politiker, der 2003 eine Rede hielt, die von vielen als antisemitisch, antiatheistisch und auch sonst reichlich ahistorisch wahrgenommen wurde. Hohmann wurde schließlich aus der CDU ausgeschlossen. In diesem Fall hat die CDU reagiert, aber nicht ohne öffentlichen Druck. Tatsächlich sind, sagen wir: wirre Ansichten bei der hessischen CDU nicht selten und gelegentlich schafft es die ein oder andere seltsame Bemerkung in die Medien, aber in den seltensten Fällen werden hieraus Konsequenzen gezogen. Warum? Das Spiel mit der Transparenz ist ein doppeltes. Es ist sicher richtig, dass die Spitzen der großen Parteien in völlig intransparenten Verfahren Entscheidungen auskungeln, die die Delegierten anschließend möglichst kommentarlos zu fressen haben. Großes Kino war für mich ja die Meldung, dass Christian Lindner, der FDP-Spitzenkandidat in NRW, sich nach seiner Nominierung den Mitgliedern erstmals vorstellte.
Es ist aber auch richtig, dass die Mitglieder den Parteien völlig intransparent sind und es kaum eine Chance gibt, sich einen auch nur halbwegs systematischen Überblick zu verschaffen. So wenig transparent die Parteispitze, so wenig ist es auch die Parteibasis. Das Leben einiger spinnerter CDU-, FDP-, SPD-Mitglieder findet eben nicht im Internet statt und ist damit auch nicht dieser großartigen Sichtbarmachungsmaschine ausgeliefert. Es gibt schlichtweg keine Möglichkeit, den Kandidaten der anderen Parteien nachzusteigen und die Mitglieder, z.B. der CDU-Landesliste für die Bundestagswahl, auf Herz und Nieren zu prüfen. Auf Abgeordneten- und Kandidatenwatch werden feingeschliffene Antworten geliefert und offline gehaltene Reden werden allzu oft nicht dokumentiert. Sicher gibt es Ausnahmen wie den Wetzlar Kurier, in dem der CDU-Rechtsaußen Hans-Jürgen Irmer seine Ansichten auf totem Baum und damit eher schwer googlebar abspeichert. Von diesem Ausnahmen abgesehen, gibt es wenig Möglichkeiten, Kandidaten wirklich gründlich zu befragen und zu durchleuchten.
Dass die Presse, aber auch die Piraten selbst, nun also Spinner verschiedener Farben in den eigenen Reihen findet, bedeutet nicht, dass es notwendig dort mehr Spinner geben muss, auch wenn dies (vgl. den ersten Unterschied) prozentual durchaus wahrscheinlich ist. Der Unterschied ist, dass bei den Piraten nicht nur keine Hinterzimmer existieren, sondern die Meinungsbildung praktisch aller Mitglieder (mich eingeschlossen) im Netz öffentlich stattfindet. Und wer weiß? Sollte ich mal in einen Aufmerksamkeitsfokus geraten, findet vielleicht jemand meine dunkle Vergangenheit bei seltsamen Vereinen wie der SPD oder in der Jugendarbeit heraus. Vielleicht erfährt auch jemand, dass ich mit Anfang 20 deutlich anti-amerikanisch eingestellt war – mit marxistischer Grundtendenz natürlich. Ich habe vor dieser Form der Sichtbarkeit weniger Angst als vor dem Angebot der anderen Parteien, die Katze im Sack zu kaufen: Bei der SPD hatte ich nie die Möglichkeit, die Kandidaten für die Delegierten-Parteitage zu befragen. Es war ein simples Ja oder Nein.
3. Unterschied: Befragbarkeit
Und genau diese Befragbarkeit ist der fundamentalste und wichtigste Unterschied zwischen den Piraten und einer herkömmlichen politischen Partei: Als es in NRW daran ging, die Liste für die vorgezogene Landtagswahl aufzustellen, meldete die taz, dass sich unter den Kandidatenkandidaten ein evangelikaler Christ befände, der wunderliche Ansichten zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zum Kreationismus verträte. Mich erschreckte das, war ich doch Ende 2009 aus der Piratenpartei ausgetreten, nachdem meine öffentliche Kritik an einem AIDS-Leugner und Impfkritiker eher Kritik an mir als an ihm ausgelöst hatte. Ich war wütend und frustriert, dass bei den Piraten öffentlich jemand erklären durfte, dass AIDS deshalb in Afrika so verbreitet sei, weil sich die Menschen dort zu wenig waschen würden. Ich habe seitdem die Piraten mit einer gewissen ambivalenten Sympathie beobachtet und zunehmend durchaus Kräfte wahrgenommen, die sich den Spinnern in den Weg stellten.
Diesmal wollte ich also nicht einfach wegsehen, sondern schauen, wie stark diese Kräfte sind und ob sich etwas geändert hätte. Ich stellte also einige Fragen in den Kandidatengrill der NRW-Piraten ein. Ich formulierte Fragen zur Sexualpädagogik, zum Biologie-Unterricht und zu den Menschenrechten lesbischer und schwuler Menschen. Tatsächlich antwortete die Zielperson auf einige meiner Fragen, wurde aber bald schwierig und beschuldigte mich der Diffamierung. Zwar erschließt es sich mir nicht, wie man jemanden, der keine heiklen Positionen vertritt, durch offene, d.h. nicht persönlich gestellte Fragen im politischen Diskurs diffamieren kann, aber ich war auch gar nicht so sehr an seinen Antworten selbst interessiert, sondern an den Reaktionen der anderen Piraten. Tatsächlich reagierten diese und fanden die Vorstellung, einen wie auch immer gearteten Schöpfungsmythos gleichberechtigt mit der Evolution im Biologie-Unterricht zu behandeln, nicht sehr erbaulich. Insofern ist es auch nicht wichtig, ob der Kreationist auch ohne meine Fragen wirklich eine Chance auf dem Parteitag gehabt hätte. Wichtig sind zwei Dinge: Erstens haben sich die Piraten so weit entwickelt, dass der Meinungsfreiheitsradikalismus einiger Piraten von 2009 offenbar einer zunehmenden Kritik an bizarrem Unfug gewichen ist. Man ist offenbar nicht mehr bereit, beliebigen Brechdurchfall mit einem Lächeln als metaphysische Errungenschaft der Verfassung zu feiern. Zweitens – und vielleicht ist das sogar das Wichtigere – habe ich gelernt, dass es richtige Orte für Fragen gibt und dass Fragen tatsächlich etwas verändern können, dass also auch bei den Piraten die Wahrheit und Klarheit vor der Wahl eine Rolle spielt.
Dies ist also der dritte Unterschied: Bei den Piraten können auch Nicht-Mitglieder Fragen stellen. Die Fragen werden nicht als freche Zumutung an den großen Vorsitzenden über die bevorstehende Elternzeit behandelt, sondern als das, was sie sind: als Fragen – als ehrliches, mitunter polemisches Informationsinteresse, dass nicht wie die Beschimpfung vernichtet, sondern den Befragten in eine Entscheidungssituation bringt. »Du darfst alles denken und alles sagen, aber ich muss es nicht gut finden.« ist das heimlich mitgesprochene Mantra aller solcher Fragen. Fragen, die so aufgefasst werden, sind Bewegungen in einem demokratischen Diskursraum, nicht lästige Artefakte einer sozialdemokratischen Marketingkampagne, die Parteitagsdiskussionen als „medial unerwünscht“ abwürgt. Sind hier Fragen unwillkommen, schienen sie insgesamt bei den Piraten, die sich größtenteils Grillfragen wünschen, eine vornehme Pflicht der Demokratie zu sein. Dialogbereitschaft bedeutet eben miteinander zu sprechen und nicht nur Monologe aneinander zu reihen.
4. Unterschied: Skandalisierbarkeit
Schließlich unterscheiden sich die Piraten in einem vierten Punkt, den man vornehm die Skandalisierbarkeit nennen könnte. Gemeint ist die positive Seite der mitunter arg unsäglichen Shitstorms. Die kurzen Wege der Kommunikation und die Offenheit der Piraten laden dazu ein, seinen Unmut über Twitter oder Mailingliste in die halb interessierte, halb indifferente Parteiöffentlichkeit zu blasen. Betrifft es ein Thema, das die eigenen Follower interessiert, wird retweetet und es entfaltet sich eine Dynamik, die vielleicht nicht immer genau abwägt, aber doch Reaktionen provoziert (wie dieser Blogpost eine ist). Der Unterschied ist, dass es diese Agora gibt, ohne dass man an der Redaktion eines Vorwärts vorbei müsste und ohne dass die eigenen Parteifreunde die Kritik als Nestbeschmutzerei auffassen würde. Die Existenz als Parteimitglied der Piraten ist wenigstens derzeit, so scheint mir, keine Verpflichtung zur bedingungslosen, d.h. kopflosen Kooperation bei der großen Marketingkampagne. Der Punkt an der Skandalisierbarkeit ist vielmehr, dass Kritik nicht als Frechheit aufgefasst wird, sondern qua Wiederholung der Kritik (Retweets, Blogs) eine Dynamik entfaltet, die es unmöglich macht, nicht mit der Öffentlichkeit im Dialog zu stehen. Dies ist ein fundamentaler Unterschied zu redigierten Parteizeitungen, offiziellen Presseverteilern und hochoffiziellen Ansprechpartnern, die darauf trainiert sind, Kritik abzuwiegeln. Es ist gleichsam eine dritte Dimension der Transparenz: Es ist leicht, die Mitglieder der Piratenpartei anzusprechen. Fasst der Schwarm das Thema als relevant auf, wiederholt er es qua Retweets, Mails und Blogs und verarbeitet die Kritik auf diese Weise.
Es sind diese vier Unterschiede, die mich diese Woche dazu bewogen haben, erneut einen Mitgliedsantrag zu stellen.
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …